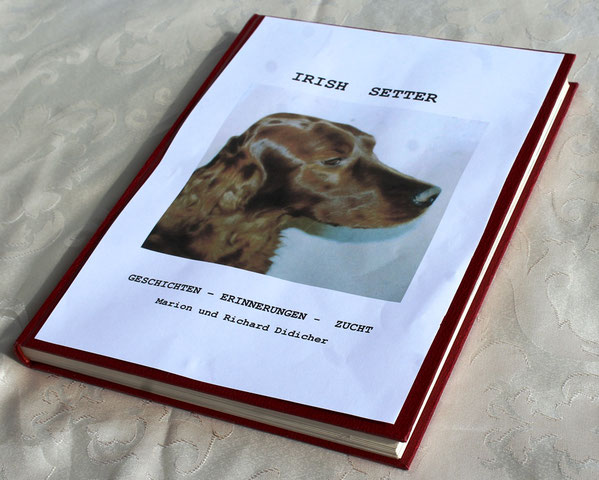Niemandsland
Die Werra, dieser
müde durch Salzlaken geschädigte Fluss, der im thüringischen Schiefergebirge entspringt, fließt die deutsch–deutsche Grenze entlang und hat viel gesehen: die willkürliche Teilung einer Nation,
das Leid der Menschen auf beiden Seiten der Grenze, die hysterische Abschottung der DDR durch Beton und Stahl, Minenfelder, Hundetrassen und Selbstschussanlagen. Auch die Gewehrsalven der
Grenzsoldaten und die Todesschreie unschuldiger Menschen blieben ihr nicht verborgen. Fast befreit trägt sie die Last ihrer Erinnerungen in die Weser, um sie danach in der weiten Nordsee zu
versenken.
Die Erinnerungen der Menschen an ihre Untaten und Grausamkeiten, an ihren Verbrechen gegen die Menschlichkeit, befohlen von einem korrupten und verlogenen System, 1000 Opfer des DDR Grenzregimes,
diese lassen sich nicht wegspülen.
Der junge Grenzoffizier Josef Wild ließ sich auf einem parallel zur Grenze angelegten Fahrweg mit Betonplatten stehend von seinem Fahrer die Grenze entlang kutschieren. Die Pose war
beeindruckend. Die eine Hand an der Hosennaht, die andere als Stütze auf dem Rahmen der Windschutzscheibe. Seine steingraue Uniform mit grüner Paspelierung und grünem Mützenrand war neu. Er hatte
die Offiziersschule in Plauen, der Kaderschmiede der DDR-Grenzoffiziere, als Jahrgangsbester abgeschlossen. Eigentlich wollte er Germanistik studieren, denn die Literatur hatte es ihm angetan.
Als Jugendlicher verschlang er alle Bücher, die ihm in die Hände kamen, vorrangig klassische Literatur. Als ihn sein Vater einmal, anlässlich einer überregionalen LPG-Sitzung mit nach Weimar
nahm, stand er vor dem Standbild von Goethe und Schiller und weinte. „Diese beiden haben uns in der Welt nicht blamiert, wie es durch die Nazis geschah. Unsere Dichter, Maler und Komponisten sind
alles, was uns Deutschen geblieben ist“, sagte er später zu seinem Vater.
Und jetzt war er als Leutnant Teil des Grenzkommandos Süd, GKS, Stab Erfurt, weil die Partei es so wollte und sein Vater nicht den Mut hatte, den Genossen zu widersprechen.
Ursprünglich war sein Vater Friedrich Wild ein streitbarer Sozialdemokrat, aber nach der Zwangsvereinigung von KPD und SPD gab er klein bei. Um sicher zu gehen, schickten ihn die Genossen für
zwei Jahre nach Moskau auf die Hochschule für Ackerbau und Viehzucht. Er kam scheinbar geläutert zurück und vertrat in der Öffentlichkeit die Grundsätze der Partei. Er wurde 1955 in einem Ort in
der Nähe von Langensalza zum LPG-Vorsitzenden ernannt. Nach außen war er stets linientreu und bemüht in der LPG die Erträge zu steigern, denn nur so konnte die DDR den Verlockungen des Westens
standhalten. „Satte Menschen sind friedlich“ war seine Devise.
Seine Mutter war eine schüchterne Flüchtlingsfrau aus dem Sudetenland, die auf der Flucht vor den Russen ihre Familie verlor und die versuchte sich allein nach Frankfurt durchzuschlagen.
Eigentlich war sie nicht allein, denn einer der Jagdhunde ihres Vaters, ein
roter Setter, wich nicht von ihrer Seite. Und wenn es mal brenzlig wurde und es galt sie zu beschützen, fletschte er die Zähne und wurde zum Raubtier.
Sie saß drei Tage am zerstörten Bahnhof von Unterberg mit ihrem abgemagerten Hund und wartete, dass ein Zug kam, doch der Bahnverkehr war längst eingestellt und so kam auch kein Zug, dafür aber
Josephs Vater, der zuerst auf den Hund aufmerksam wurde und sein Herz höher schlagen ließ. Er fragte nach dem Namen des Hundes und wollte auf ihn zugehen und ihn streicheln, doch die Frau wehrte
ab: „Ich bin die Susanne, er heißt Bodo und greift jeden fremden Mann, der mir zu nahe kommt, an“, sagte sie.
„Wollen wir mal sehen“ sagte Josephs Vater und er strich dem Hund vorsichtig über den Kopf. Dieser blickte mit seinen sanften Augen zu ihm hoch und beschnupperte ihn.
„Wahrscheinlich riecht er unsere Hündin Bianca. Als ich von der Front verwundet zurückkam, fand ich in unserem zerbombten Haus nur noch den Setter. Meine Eltern hatten den Krieg nicht
überlebt.
„Wenn Sie Hunger haben, Susanne und sich aufwärmen möchten, können Sie mich begleiten, ich habe zwei Zimmer notdürftig repariert und außerdem habe ich heute mit der Flinte meines Vaters, die ich
in den Trümmern fand, einen Hasen geschossen.“ Die Frau nickte, nahm Bodo an die Leine und folgte wortlos.
Ein Jahr danach kam Joseph zur Welt.
Und dieser fuhr jetzt auf einem holprigen Grenzweg, sah von Zeit zu Zeit auf die westdeutsche Seite und dachte an die kleine Marie aus Oberberg: „Wenn sie ihn so sehen würde“, doch er verwarf den
Gedanken sehr schnell, denn sie lebte jetzt im Westen und gehörte zu den imperialistischen Klassenfeinden.
Früher verband die beiden Dörfer Unterberg und Oberberg eine einfache Straße und die Kinder beider Orte spielten miteinander. Die Bewohner beider Dörfer kannten sich und nicht selten wurden auch
Ehen zwischen jungen Menschen beider Orte geschlossen.
Auf der Potsdamer Konferenz wurde durch die Siegermächte Deutschland willkürlich aufgeteilt und plötzlich gehörte Unterberg zur russischen Besatzungszone und Oberberg zur amerikanischen.
Die ersten Jahre nach der Teilung änderten kaum etwas am Leben der Menschen. Armut, Hunger und Trauer um die im Krieg Gefallenen gab es überall in Deutschland.
Jeder versuchte sich selbst zu helfen, so auch Friedrichs Vater. Morgens in aller Herrgottsfrüh nahm Friedrich Wild Bianca und Bodo an die Leine, die zerlegte Flinte war im Rucksack verstaut,
sein Nachbar, der hagere Müller stand schon vor dem Hoftor und beide schlichen sich in die Felder. Die Hunde suchten die Wiesen ab und jedes Mal, wenn sie Wild witterten, standen sie wie
angewurzelt, so dass sich Friedrich anschleichen konnte. Ein Knall und schon gab es einen Hasen, einen Fasan oder Rebhühner für den Rucksack. Natürlich bekamen auch die Hunde, die nicht sehr
wählerisch waren, etwas von der Beute ab.
Nachmittags suchten die beiden Männer nach Obst in den Obstwiesen, die nicht mehr bestellt und so von Brennesel überwuchert waren. Jetzt waren auch die Kinder dabei. Marie, die Nachbarstochter,
und Joseph.
Wenn die beiden keine Lust mehr hatten Beeren zu pflücken, spielten sie mit Bodo, dem Flüchtlingshund und Bianca, der Trümmerhündin, wie Josephs Mutter die beiden manchmal nannte, auf der Wiese.
Maries Vater sagte dann zu Josef: „Du musst mir versprechen, auf sie aufzupassen, dass sie nicht in den Bach fällt. Sie ist so stürmisch wie ein junger Setter.“ Josef erwiderte dann: „Mach ich,
ich verspreche es, ich werde immer auf sie aufpassen.“ Marie wurde bei diesen Worten ganz rot und als sie allein waren, schenkte sie ihm ein weißes Taschentuch mit angeblich seinem eingestickten
Namen, der nur aus einigen unbeholfenen Stichen bestand.
Ein bescheidenes Leben in einer zerstörten Welt bahnte sich an und die angebliche Grenze interessierte keinen. Bis zu dem Tag Anfang 1952, der alles veränderte.
Holzfäller aus den thüringischen Wäldern wurden angekarrt, aber auch andere Menschen aus den Dörfern der Werra entlang. Sie wurden von Volkspolizisten begleitet und hatten die Aufgabe, das
Gelände an der Grenze frei zu machen, zu glätten und einen Grenzstreifen zu ziehen.
SED-Funktionäre, die nach Unterberg kamen, erkundigten sich nach Menschen, die unzuverlässig und nicht linientreu seien. Man munkelte, dass diese in den nächsten Tagen ins Landesinnere
umgesiedelt werden würden. Diese Aktion hatte den menschenverachtenden Namen „Ungeziefer“. Zwei Funktionäre erkundigten sich ausführlich bei Friedrich Wild, den sie für einen der ihrigen hielten,
über seinen Nachbarn Hans Müller. Während des Gesprächs stellte sich heraus, dass sie gut informiert waren und dass sie auch über die morgendlichen „Jagdzügen“ der beiden Bescheid wussten.
„Wir nehmen es ihnen ja nicht übel, dass sie ihre Familie versorgen, aber sie müssen mit uns zusammenarbeiten, da sie als Sozi seit 1946 jetzt auch zur SED gehören.“ Dies bejahte Friedrich
natürlich, gelobte Zusammenarbeit und wartete nur, bis beide weggefahren waren, um über den Gartenzaun seinen Nachbar zu warnen.
Am nächsten Morgen, als Joseph Marie zum Spielen abholen wollte, war das Haus leer.
Später erfuhr man, dass Hans Müller in der Nacht seine Schwiegereltern und die beiden Schwager in Oberberg besucht habe. Es fanden sich acht mutige Männer, die ihm halfen sein gesamtes Hab und
Gut über die provisorische Grenze zu bringen.
Die Partei schien aber von Friedrichs Antwort auf die Frage, ob er von dem nächtlichen Auszug der Nachbarn nichts mitbekommen habe, nicht überzeugt. Dieser versicherte, er habe versucht seine
Zahnschmerzen mit Schnaps zu ertränken und fest geschlafen.
Einige Tage danach erhielt er die Mitteilung, dass ihm von höchster Stelle für zwei Jahre ein Stipendium zum Studium nach Moskau, das er nicht ablehnen könne, zugesprochen wurde.
Seine Frau war verzweifelt, doch Friedrich Wild meinte nur: „Ablehnen ist zwecklos, vielleicht warten sie gerade darauf, dass wir einen Fehler machen. Du und Joseph werdet gut versorgt
sein.“
Der kleine Joseph schlich an den folgenden Tagen immer wieder ums Nachbarhaus, es konnte doch nicht wahr sein, dass seine Freundin ihn verlassen hat. Sie waren doch gestern noch zusammen Maikäfer
für die Hühner sammeln.
Die Straße an der Grenze wurde immer holpriger und die Fahrt immer schwieriger. Leutnant Joseph wachte aus seinen Träumen auf und plötzlich kam er sich lächerlich in dieser Pose vor, erinnerte
sie ihn doch eher an die Bonzen des dritten Reiches, denen das Volk zujubelte. Ihm jubelte niemand zu und als sie eine Anhöhe hoch fuhren, waren sie gut auf dem anderen Teil der Grenze sichtbar
und prompt von einer Gruppe junger Klassenfeinde aus ihrem Ford Capri mit einem Hupkonzert begrüßt.
Er nahm wieder auf dem Beifahrersitz Platz, wandte sich zum Rücksitz und streichelte lange in Gedanken versunken seinen jungen irischen Setter Lucas.
Als er seine Tour beendet hatte, stieg er auf den Kontrollturm. Vorher musste er sich von einem Untergebenen die alten Witzeleien anhören: „Ach, das Schoßhündchen lebt ja noch, hatte wohl Glück,
dass er den Trassenhunden nicht zu nahe kam, denn diese kennen keinen Pardon, weder mit Mensch noch Tier, das sind echte DDR-Schäferhunde.“ Da ihm die Sprüche auf die Nerven gingen, sagte er nur:
„Morgen zwei Schichten für dich“ und nahm auf der oberen Etage eines Kontrollturms Platz. Mit seinem Zeiss-Fernrohr hielt er Ausschau nach den Republikflüchtigen. Oder suchte er vielleicht die
Wiesen im Feindesland nach einer jungen Frau mit einem roten Hund ab, die jeden Abend einen Setter spazieren führte?
Wenn er sie sah, zoomte er sie heran, so nahe, dass er ihr Gesicht und ihre Augen sehen konnte und er hatte keine Zweifel: die gleichen Augen, dieselben Grübchen in den Wangen. Es musste Marie
sein. Und wenn der Setter dann mal wieder einen Hasen hochmachte und ihm das Geleit gab, dachte er an die boshaften Worte seines Vaters: “Setter bevorzugen Frauen, weil sie diese besser
austricksen können.“
Mit hereinbrechender Nacht, übergab er das Kommando an seinen Untergebenen, ging in die Kaserne, legte sich auf das Bett und dachte jeden Abend das Gleiche: „Gott bewahre uns vor einem
Grenzgänger, ich will keinen Menschen töten.“ Seine Mutter, die eine gläubige Frau war, sagte immer: „Bete, wenn du in Nöten bist, aber leise, denn nur die Gedanken sind frei.“ Und er wusste auch
an diesem Abend nicht, wie er sich bei einem wirklichen Zwischenfall verhalten würde. Gut, dass er ein Zimmer für sich hatte, denn das Misstrauen der einzelnen Offiziere untereinander war groß,
jeder konnte zur Stasi gehören.
Lucas nahm neben ihm Platz, drückte sich fest an ihn und so schliefen sie ein.
Eigentlich dürfte es Lukas gar nicht geben, denn in der DDR gab es für alles Reglementierungen und selbstverständlich auch für die Hundezucht. In jedem Wurf durften nur acht Welpen am Leben
bleiben. Die anderen wurden „gemerzt“. „Welch hässlicher Ausdruck“ schimpfte Josephs Vater, natürlich nur, wenn sie allein waren. „Merzen statt Töten, wir Deutschen sind Meister im Beschönigen
und Verfälschen der Worte. Und dabei widerspricht diese Aussortierung allen Gesetzen der Genetik“ Denn von dieser Wissenschaft, die allmählich auch in der Tierzucht Einzug hielt, hatte er bei
Fortbildungen über die Auswahl der Zuchttiere in der Viehzucht einiges mitbekommen.
„Wie kann ich sehen, welcher Hund über die besten Erbmerkmale verfügt, wenn ich manchmal ein Drittel nach der Geburt töten muss? Das sind faschistische Methoden“, schimpfte er abends, wenn das
Hoftor verschlossen war und er und seine Frau sich ins Schlafzimmer zurückgezogen hatten, wo auch die Körbe für die Hunde und der Fernseher stand. Was ihn genauso nervte war der „Antrag auf
Deckrüdenzuweisung“, den er ausfüllen sollte. „Bald wird auch für die Menschen gelten: eine Genossin und ein Genosse und vorher ein Antrag an die Partei!“ schimpfte er. Obwohl seine Frau ihn
warnte, ließ er es sich nicht nehmen, jeden Abend das Westfernsehen einzuschalten und wenn Brandt eine Rede hielt, hörte er andächtig zu.
Das Schlafzimmer hatte keinen Telefonanschluss und konnte so nicht verwanzt werden. Als LPG-Vorsitzender waren ihm die Stasimethoden nicht fremd. Das ist unser sicherer abhörgeschützter Bunker
lästerte er manchmal, wenn er mit seiner Frau allein war.
Und Joseph flüsterte er öfter zu: „ Wir wären Narren, wenn wir uns ihnen widersetzten, denn sie haben die Macht. Mit den Wölfen heulen heißt nicht ein Wolf zu sein. Früher, als die Kirchenglocken
läuteten, haben unsere Setter auch geheult, aber sie waren beileibe keine Wölfe. Joseph, du musst ihnen immer sagen, was sie hören wollen, Aufrichtigkeit und Zusammenhalt gibt es nur in der
Familie.“
Randbemerkung des Autors: Ob Vater und Sohn, die ja beide zu Aufsteigern und Profiteuren dieses Systems wurden, obigem Grundsatz treu blieben, ist fraglich.
Während eines Besuchs bei seinen Eltern, stellte Leutnant Joseph sofort fest, dass sein Vater an diesem Tag etwas fahrig und leicht nervös war. Er bat zum ersten Mal seinen Sohn, die Uniform
abzulegen, er sagte nur :“So ist es mir lieber, so sehe ich meinen Sohn und nicht die geballte Staatsgewalt“, danach bat er ihn ins Schlafzimmer und führte ihn an die Wurfkiste: „Neun gleiche und
gesunde Welpen und einer muss getötet werden, das geht nicht in meinen Kopf!“
Joseph streichelte die Welpen, jeden einzelnen, wie er es als Kind schon immer getan hatte, dann richtete er sich auf und sagte: „Vor der Wurfabnahme komme ich wieder und dann nehme ich den
Welpen mit dem weißen Brustfleck mit. Er wird Lukas heißen. Dann sind es nur noch acht. Leutnant Joseph Wild ist nicht verpflichtet, Auskunft über die Herkunft seines Jagdhundes zu geben.“
Es trifft sich gut, da sie mir sowieso den Jagdschein als kleine Anerkennung zugeschickt haben.
Erleichtert umarmte der Vater seinen Sohn.
Und so nahm das Schicksal seinen Lauf. Lucas wuchs zu einem prächtigen Setter heran. Er war hochnäsig und schön. Wenn die „Trassenhunde“, die es der Grenze entlang an manchen Stellen noch gab,
ihn wütend ankläfften, drehte er überheblich den Kopf in die andere Richtung. Joseph tadelte ihn dann: „Die armen Kerle würden gern mit dir tauschen, sei nicht so arrogant.“
Abends, wenn sie allein im Wachturm saßen, scherzte Joseph: „Wenn du ein Mensch wärst, würde ich dir mein Zeiss-Fernglas ausleihen. Die unerzogene Setterhündin im Feindesland, die eine Frau an
der Leine hinter sich herzieht, ist eine wahre Pracht. Lucas hob dann die Nase und begann zu schnuppern und Joseph war sicher, dass sein roter Freund alles verstand.
Am 1. Mai, am sogenannten Internationalen Kampf- und Feiertag der Werktätigen für Frieden und Sozialismus, fuhr Leutnant Joseph mit Lucas in die Stadt. Er trug wie die meisten Grenzer bei ihren
seltenen Ausgängen keine Uniform. Die Beliebtheit der „Elitetruppe“ hielt sich bei den Genossen in Grenzen. Bei einem Tanzfest - Lucas lag brav ohne Leine unter einem Biertisch - lernte er die
FDJ-Sekretärin der Gegend kennen. Diese war wenig zimperlich und lud ihn sofort zu sich in die Wohnung ein. Im Treppenhaus zeigte sie Joseph eine Stelle, wo er Lucas anleinen könne. Damit endete
die Liebelei, bevor sie begonnen hatte.
Bei einer hübschen Genossin auf einem LPG-Fest waren es die Katzen, die Lucas durch das Haus scheuchte. Die Krönung seiner Störmanöver leistete sich Lucas, als er bei einem gemütlichen
Spaziergang am Bach Josephs Auserwählte schockte, indem er einer Ente hinterher schwamm und das nasse Federvieh der jungen sensiblen Kunststudentin vor die Füße legte.
„Du machst mich zum alten Junggesellen mit deiner flegelhaften Art“, schimpfte Joseph, um dann am Abend sein Fernglas zur Hand zu nehmen und die „kapitalistischen“ Wiesen abzusuchen.
Ohne große Aufregung verging ein Tag wie der andere. Acht Stunden Dienst, acht Stunden Bereitschaft, acht Stunden Schlaf. Besondere Vorkommnisse gab es kaum: ein eingeschlafener Grenzposten, der
in den Bau musste, Missachtung des Rauchverbots beim Dienst, Streit schlichten zwischen den Soldaten und wieder war für die Betroffenen Bau fällig.
Doch dann kam der Tag, den Joseph nie vergessen würde. Seine Gruppe hatte an diesem Abend Bereitschaft. Er hatte den Kontrollgang abgeschlossen und war gerade dabei „keine besonderen
Vorkommnisse“ in seinen Bericht zu schreiben, als das Sirenengeheul ihn aufschreckte. Leuchtraketen tauchten den Grenzstreifen in ein grelles Licht, dann folgte eine Gewehrsalve. Joseph stürzte
zur Tür hinaus und trommelte seine Mannschaft zusammen.
Das Bild, das sich Joseph bot, war grauenvoll.
Eine junge Frau lag blutüberströmt auf dem Grenzstreifen. Sie schrie vor Schmerzen. Neben ihr kniete ein Grenzsoldat und stammelte immer wieder: „Bitte vergeben sie mir, ich wollte doch nur einen
Warnschuss abgeben.“
Joseph versuchte die Frau aufzurichten, doch sie sank immer wieder in sich zusammen, dabei flüsterte sie mit schwacher Stimme: „Ich wollte doch nur zu meinem Mann. Wir haben in Ungarn am
Plattensee geheiratet. Ich trage sein Kind in mir.“
Joseph sah verzweifelt in die Runde: „Wo sind die Sanitäter? Schafft sie endlich herbei“, schrie er mit heiserer Stimme. Als diese kamen, war es zu spät. Die Frau starb in Josephs Armen.
Am nächsten Morgen erfuhr man, dass sich der Schütze in der Nacht erschossen habe. Es war ein junger schmächtiger Mann, der so gerne Musik studieren wollte. Er hatte sich freiwillig zur Grenze
gemeldet, um anschließend zum Studium zugelassen zu werden.
Am nächsten Tag kam General Oberst Erich Franz aus Berlin. Leutnant Joseph Wild erhielt vorher einen Anruf, er solle alle dienstfreien Grenzsoldaten für Punkt 12 Uhr zum Appell antreten
lassen.
Leutnant Joseph Wild erstattete Bericht: Vorkommnisse der letzten Nacht: Zwei Todesopfer, ein Grenzsoldat und eine Privatperson. Der Generaloberst winkte ab, zog ein Papier aus der Tasche und
las: „Fähnrich Ulf Fink hat durch seinen Heldenmut einen Grenzdurchbruch von Ost nach West verhindert. Die DDR-flüchtige Person wurde von ihm gestellt. Sein heldenhafter Dienst für die deutsche
demokratische Republik macht uns stolz. Er ist in Erfüllung seiner patriotischen Pflicht gestorben. Am 1. Dezember, dem „Tag der Grenztruppen“, werden wir seiner Gedenken“.
Scherzhaft fügte er hinzu: „Auf Salutschüsse werden wir hier verzichten, sonst glaubt der imperialistische Westen, dass wir ihn angreifen.“
Er warf einen Blick auf Lucas, der sich für die Vorträge nicht zu interessieren schien und gemütlich in die Sonne blinzelte. Der Hund missfiel ihm und so grunzte er beim Warten auf seinen Fahrer,
der dabei war, die Hintertür des schwarzen Moskwitsch zu öffnen: „Du taugst nicht als Trassenhund, weil dir der Biss fehlt und als Jagdhund verwechselt man dich mit einem Reh.“
Und die tote, namenlose, vergessene Frau?
Auf der anderen Seite der Grenze wartete ein Mann tagelang vergebens.
Der Oberst war bereits eingestiegen, doch das Fahrzeug fuhr nicht los. Alle standen in Reih und Glied aufgereiht mit der Hand an der Mütze um den Gast zu verabschieden.
Dieser unterhielt sich mit seinem wild gestikulierenden Adjutanten, von dem alle wussten, dass er zur Staatssicherheit gehörte, im Inneren des Wagens. Plötzlich stieg der Oberst wieder auf aus,
wandte sich mit folgenden Worten an Leutnant Wild: „Genosse Wild, ich suspendiere Sie mit sofortiger Wirkung vom Dienst. Sie haben Sympathie zu einer Republikflüchtigen gezeigt und erste Hilfe
geleistet, das ist untersagt. DDR-Flüchtlinge sind Verbrecher. Ihr Stellvertreter übernimmt ab sofort all ihre Pflichten.“
Joseph wagte zu erwidern: „Es war eine schwer verletzte, schwangere Frau.“
„Also zwei Flüchtige“ sagte der Oberst. Er stieg ein und das Auto setzte sich in Bewegung.
Joseph übergab alle Protokolle seinem Untergebenen, tauschte die Uniform gegen seinen schlichten Anzug, nahm Lucas an die Leine und ging zum Bahnhof. Einige der Soldaten riefen ihm hinterher:
„Wild, du bist ein Verräter“. Die Fahrt mit dem Zug zu seinen Eltern war durch das zweimalige Umsteigen recht mühsam. Mit dem Dienstwagen brauchte er vorher nur eine knappe Stunde. Er traf am
späten Nachmittag zu Hause ein. Als er das Tor öffnete, traute er seinen Augen nicht. In der Einfahrt stand ein schwarzes Fahrzeug mit Diplomatennummer. Auf der Veranda saß sein Vater und trank
Wodka mit einem schwarz gekleideten Mann. Dieser rief ihm zu: „Syn moyego druga, Sohn von Freund, was für ein roter sobaka hast du, ist sicher russisch. Lass hier be tvoy Vater. Er macht Schmutz
in mashinui. My idem v kazarmy, fahren zurück. Joseph konnte nicht antworten. Er sah seinen Vater an, dieser nickte. Er umarmte seine Mutter und sie fuhren los. Die ganze Strecke sprach der
unheimliche Mann kein einziges Wort.
Als sie in der Kaserne ankamen, war es fast dunkel und dennoch standen alle in Reih und Glied. Selbst der Oberst, der wieder angereist war, riss die Hacken zusammen und salutierte. Der Diplomat
würdigte ihn keines Blickes. Zu Joseph sagte er: „Zieh uniformu an, naden'te uniformu leytenant“.
Er küsste Joseph nach russischem Brauch auf die Wange, drehte sich zu Oberst Franz und brüllte ihn an: „Mach keine Fehler Genosse Oberst, ich lasse für dich Gulag in Sibirien wieder aufbauen. Die
Sowjetunion ist groß und wir sagen dir, was gut oder schlecht ist.“ Er zwinkerte Joseph zu, stieg in den Wagen und der Fahrer fuhr los.
Oberst Franz winkte seinen Fahrer herbei, murmelte mit finsterer Miene zu Joseph: „Nichts für ungut Leutnant Wild, nehmen Sie sich in Acht“ und weg war er.
Natürlich löste der Diplomatenbesuch bei Friedrich Wild im Dorf heftige Spekulationen aus: Wild ein KGB Spion, Wild als zukünftiger Außenminister der DDR? Andere glaubten zu wissen, dass der alte
Wild als junger Mann bei seinem Studium in Moskau durch einen waghalsigen Sprung in die Moskwa dem Kind eines hohen Regierungsbeamten das Leben gerettet habe. Letztere Variante könnte der
Wahrheit näher kommen.
Für Leutnant Joseph Wild war diese Demütigung durch seinen Vorgesetzten eine Wende in seinem Leben. Das Heitere und Leichte, das trotz dieses grotesken Dienstes in ihm schlummerte, war über Nacht
verschwunden. Besonders die Schadenfreude seiner Untergebenen bei seiner Suspendierung nagte in ihm.
Zu seinem Setter Lucas blieb er weiterhin freundlich. Wenn sie abends allein im Zimmer waren, sprach er mit ihm. Oft war es belangloses Zeug oder es waren Kindheitserinnerungen an die Zeit mit
Marie in Unterdorf. Lucas hörte aufmerksam zu und man konnte glauben, dass er alles verstand, denn bei Geschichten, die auch ihn betrafen, begann er plötzlich mit der Rute zu wedeln. Oft erzählte
er Lucas auch wie schön es wäre, mit der jungen Frau mit dem Setter durch die grünen Wiesen einer freien Welt zu laufen. Wenn er dann den Finger auf den Mund legte und zu Lucas sagte: „Unser
Geheimnis“, fiepte diese, so als hätte er alles verstanden.
Im Alltag war Joseph wie ausgewechselt. Er hatte endlich das begriffen, was viele Menschen aus den Ostblockstaaten ausmachte: eine strikte Trennung zwischen Innen- und Außenleben.
Nach außen verkörperte Leutnant Wild den DDR-Offizier, der Wert auf strikten Dienst nach Vorschrift legte.
Unpünktlichkeit bei Dienstantritt bedeutete für die Soldaten Streichung des Ausgangs für einen Monat; Trunkenheit bedeutete drei Tage Arrest. Einschlafen während des Grenzdienstes bedeutete
Verlust des Urlaubs.
Er führte die gefürchteten Politabende mit Frage-Antwort-„Spiel“ wieder ein.
Wenn Fragen wie „Warum müssen wir die DDR-Grenze beschützen?“ lapidar mit „um Flüchtlinge zu erschießen“ von einem Soldaten beantwortet wurde, betraf die Reglementierung nicht nur den
Betreffenden, sondern auch seinen Zugführer. Beide mussten hundert Mal den Satz „Verletzung der Grenze von Ost nach West durch Saboteure und Reaktionäre aus dem Westen müssen verhindert werden.
DDR-Flüchtige sind zu stellen“ schreiben.
Natürlich führte diese Maßnahme dazu, dass das Verhältnis zwischen Fähnrichen und den Untergebenen nicht das Beste war. Hass, Misstrauen und Verpetzen waren an der Tagesordnung.
Besonders schlecht kamen bei ihm die Söhne des Staatsicherheitsapparats weg. Oft prahlten diese verwöhnten Jasager mit der Tätigkeit der Eltern. Für sie war der Grenzdienst nur ein Sprungbrett
für einen Studienplatz und deshalb waren sie bemüht sich anzubiedern und zu gefallen.
Leutnant Wild scherte sich wenig darum, Hauptsache war, dass die Stasispitzel in der Kaserne sein Durchgreifen zum Wohle des Arbeiter- und Bauernstaates an ihre Vorgesetzten weitergaben, was
natürlich regelmäßig erfolgte.
Eine Beförderung ließ bei einem derartigen Pflichtbewusstsein nicht lange auf sich warten.
Oberleutnant Wild wurde jetzt mit anderen Aufgaben betraut. Er übte ab sofort auch Kontrollfunktionen über andere Grenzsektionen aus. Die Auseinandersetzungen mit dem „Fußvolk“ blieben ihm
erspart.
Ihm stand ab sofort ein geräumiges möbliertes Zimmer zur Verfügung.
Bei seinen „Dienstfahrten“ verzichtete er manchmal auf seinen Fahrer, so dass er zwischendurch an einem stillen Ort anhalten und mit Lucas einen Spaziergang machen konnte.
Private Gespräche mit Soldaten lehnte er ab. Er hasste geradezu Menschen, die versuchten durch Schmeicheleien sein Wohlwollen zu erkaufen.
Er erinnert sich immer wieder an die Worte, die sein Vater ihm bei Dienstantritt mitgab:“ Suche dir deine Freunde selbst aus und sei vorsichtig und wählerisch. Halte Menschen auf Abstand, die
dich angeblich bewundern, sie erhoffen sich nur Vorteile, du bist ihnen egal, sie werden dich eiskalt verkaufen. In dieser Welt gibt es viele Denunzianten, benutze sie, aber halte sie immer auf
Abstand.“
Joseph war oft einsam, doch nie allein, denn er hatte Lucas, der stets an seiner Seite war.
Und da waren ja auch noch die Besuche bei seinen Eltern. Joseph genoss diese Tage. Am liebsten saß er mit seiner Mutter auf der Veranda und lauschte ihren Geschichten über den Bauernhof ihrer
Eltern im Sudetenland. Herrliche Wälder, Flussauen in einem satten Grün mit weidenden Kühen, ein Garten voller Geflügel; eine beschauliche Welt, bis die Russen kamen und über das Gartentor hinweg
zwei der drei Jagdhunde des Vaters erschossen. In der gleichen Nacht packte die Familie ihren Leiterwagen und sie fuhren los.
Wenn der pompöse russische Freund des Vaters auftauchte, blieb sie höflich, doch sie mochte ihn nicht.
Oft pflegte sie zu sagen: „Die Welt kann man nicht durch Arbeitslager besser machen, sondern nur durch Bildung.“ Was würde ein Dostojewski, Tolstoi, Gogol, Bulgakow oder ein Puschkin denken, wenn
sie diese „armselige Diktatur des Proletariats“ und die „geschundene russische Seele“ erleben müssten?“
Joseph war verblüfft über derartige Aussagen der Mutter und er fragte sie, woher sie all diese Autoren kenne und sie bemerkte nur, dass diese Schriftsteller genau wie Goethe und Schiller auch
ihren Platz in der Weltliteratur hätten.
„Die heutige Jugend kennt solche Bücher nicht, dafür müssen junge Menschen einen Strittmatter lesen oder sie werden mit Theorien über den „Sozialistischen Realismus“- eine groteske Erfindung der
Kulturfunktionäre-„ gefüttert“, fügte sie hinzu.
Auch Lucas schienen solche Gespräche zu interessieren. Oder lauschte er nur so andächtig den Worten der Mutter, weil sie fast zufällig einen Belohnungshappen fallen ließ?
Allein der Vater wurde bei solchen Gesprächen unruhig und von Zeit zu Zeit schlug er vor, das Thema weiter im abhörsicheren „Schlafzimmerbunker“ weiterzuführen.
Irgendwie schien der Vater mit seinen Gedanken weit weg zu sein.
Als ihn Joseph endlich fragte, was los sei, platzte es aus ihm heraus: „In einer Woche soll hier eine Treibjagd zu Ehren unseres großen Genossen Honecker stattfinden. Die Maisernte ist noch in
vollem Gange und die Zuckerrübenernte ist auch noch nicht abgeschlossen. Gestern erhielt ich die Anweisung, den Mais samt Kolben einzuackern, damit alles „blitz-blank“ sei. Es ist ein Verbrechen.
Da müht man sich ein ganzes Jahr mit dem Getreide ab, um vor der Ernte mehr als zehn Tonnen Mais zu verscharren, damit die Optik stimmt. Übrigens ist der Genosse Oberleutnant Joseph Wild auch als
Schütze eingeladen, welch eine Ehre. Ich soll den Treiber machen. Gut, dass der Dorfarzt mir bereits eine Verstauchung des linken Köchels bescheinigt hat“, fügte er spöttisch hinzu.
Bevor sich Joseph verabschiedete, nahm er seine Mutter, die er bedingungslos liebte, in den Arm und flüsterte ihr zu:
„Ich verspreche dir, Mutter, in meinem nächsten Urlaub werden wir beide den Ort deiner Kindheit und Jugend besuchen. Die Tschechoslowakische Republik ist jetzt unser kommunistisches Bruderland
und ein Visum dürfte für mich kein Problem sein“.
Er war überrascht als sie ihm mitteilte, dass sie dies nicht wünsche: „Ich will die Bilder meiner Kindheit nicht zerstören durch eventuelle unangenehme Überraschungen“, sagte sie, was ihr Sohn
durchaus verstand.
Lucas lag jetzt entspannt bei den anderen Hunden, er schien zu schlafen, doch mit einem Auge beobachtete er ständig Joseph, denn es könnte ja das Zeichen zum Aufbruch geben. Als dieser seine
Jacke überzog, war Lucas plötzlich hellwach. Das fiel auch der Mutter auch und sie meinte, dass Hund und Herr ein hervorragendes Team seien, da Lucas jede kleine Geste Josephs verstand.
Da Oberstleutnant Wild freitags noch Dienst hatte, fuhr er Samstagmorgen nach Hause zurück, um bei der Treibjagd dabei zu sein. Es stand außer Frage, dass ein Fernbleiben für ihn Konsequenzen
bedeutet hätte. Schweren Herzens nahm er auch Lucas mit, denn er kannte all die traurigen Geschichten, dass bei solchen Veranstaltungen die schießwütigen Teilnehmer nicht selten einen Irischen
Setter mit einem Reh verwechselt hätten. Auf der Fahrt hielt Joseph seinem Gefährten eine Standpauke nach der anderen, dass dieser stets in seiner Nähe zu bleiben habe, und dass kein Wild so
verführerisch rieche, um diese Regel zu brechen.
Als sie durch die Hauptstraße des Dorfes fuhren, sah dieses wie verwandelt aus. Junge Pioniere in weißen Hemden mit blauen Halstüchern hielten Plakate mit der Inschrift „Wir kämpfen um hohe
Lernergebnisse“ hoch, andere versuchten eifrig die Grundschüler in Reih und Glied am Straßenrand aufzustellen.
Überall gab es Plakate mit Honeckers Gesicht und dazu passende Losungen: „Vorwärts immer, Rückwärts nimmer.“
„Meinem Friedensstaat, meine Friedenstat“, Joseph musste dabei unweigerlich an die getötete Frau an der Grenze denken.
Zwei junge Frauen hielten ihre Losung „Folgt dem Beispiel unserer Partei, arbeitet und lebt sozial“ so hoch, dass sie umkippte und die Kleinsten überdeckte. Zwei Kinder rannten in Panik
davon.
Zwei Freunde seines Vaters aus der LPG trugen ein Schild: „Gute Qualität in der Arbeit ist ein Beitrag zur Stärkung der DDR“.
Joseph wurde zur Seite gewinkt. Er hielt seinen Lada an und stieg aus.
Im gleichen Moment brauste die Autokolonne des Personenschutzkommandos vorbei. Es folgten „fremdartige Geschöpfe“ aus kapitalistischer Produktion (Volvo, Mercedes G, Citroen CX Prestige, Toyota),
die Fahrzeuge der Diplomaten und hohen Funktionäre, gefolgt von einem grünen Range Rover mit einem massiven Rammschutz, elektrischer Seilwinde und großen Scheinwerfern. Ein blasses Gesicht mit
schwarzer Hornbrille auf dem Rücksitz schien zu winken. Oberleutnant Wild schlug automatisch die Haken zusammen und salutierte.
Als Nachhut folgten zwei Geländewagen mit Wachleuten.
Zurück blieben in Staub eingehüllte Trabis am Straßenrand und Menschen, die ihre Losungen zusammenrollten und sich auf den Rest des freien Tages freuten. Die Kinder packten ihren Fußball aus und
verschwanden auf dem Bolzplatz des Dorfes.
Oberstleutnant Wild war vorerst einmal beschäftigt den aufgeregt kläffenden Lucas zu beruhigen, denn diesem war das alles nicht geheuer.
Joseph stattete seinen Eltern einen kurzen Besuch ab. Nachdem er seine Uniform durch die Jagdkleidung ausgetauscht hatte, fuhr er ins Jagdrevier. Er fuhr an kahlen „abrasierten“ Feldern vorbei.
An manchen Stellen wurde das Maisstroh mit den reifen Kolben nicht ganz untergepflügt und Joseph musste an die traurigen Worte seines Vaters denken.
Nach zweimaliger Ausweiskontrolle wurde er den Schützen zugeteilt und er durfte das riesige Zelt betreten. Massive Stützpfeiler aus Metall, die Wände und der Boden mit Tannenreisig bedeckt. Ein
Duft von frisch geschlagenen Tannen übertönte den Zigarettenqualm. Etwas abgelegen gab es das Zelt der Treiber, das weniger aufwendig ausgestattet war. Nach einigen Minuten wurde Oberstleutnant
Wild an den Ehrentisch gebeten.
Er trat an den Tisch und salutierte in perfekter Manier.
Der Mann mit der schwarzen Hornbrille blätterte in seinen Aufzeichnungen. Als er den Namen fand, sah er hoch: „Genosse Oberstleutnant Wild, nach Aussagen unseres russischen Freunds sollen Sie
einer der Besten sein. Als Offizier der Grenztruppe kämpfen Sie am antiimperialistischen Schutzwall an vorderster Front. Waidmannheil, Genosse Oberstleutnant. Abtreten.“ „Danke der Ehre, Genosse
Staatsratsvorsitzender“ erwiderte der junge Grenzoffizier.
Erst dann sah Honecker Lucas, der an der linken Seite seines Herrn artig in der Sitzposition verharrte.
„Aber was wollen Sie denn bei einer Großwildjagd mit diesem Hühnerhund?“ Joseph strich Lucas über den Kopf und erwiderte: „ Er ist jeder Aufgabe gewachsen und hat meine Erwartungen stets
erfüllt.“ Der Oberstleutnant schlug die Hacken zusammen, salutierte und zog sich zurück. Das Gelächter am Tisch bekam er nicht mehr mit, aber er fragte sich, ob er mit Lucas nicht zu sehr
„aufgetragen“ habe.
Nach der Vorstellung aller Gäste rief der Jagdleiter die Beteiligten zum Aufbruch auf:
„Sputet euch ein bisschen, ihr wisst, Genosse Mittag will um 18 Uhr seinen ersten Hirsch schießen.“ Der Witz schien angekommen zu sein und alle setzten sich in Bewegung.
Am Waldrand mit Ausblick auf eine ausgedehnte Wiese befanden sich die Kanzeln.
Für die hohen Parteifunktionäre und die honorigen Staatsgäste wurde eine Tribüne aufgestellt mit bequemen Sitzen und einer Balustrade zum Auflegen der Waffen. Oberstleutnant Wild und die anderen
Offiziere verteilte man auf Hochsitze im gebührenden Abstand zur Ehrentribüne.
Plötzlich vernahm man Treiberlärm und etwas später wurde ein Rudel stattlicher Rothirsche, die aus ungarischen Gehegen stammten, auf die Wiese getrieben. Die Tiere, die kaum in der Lage waren
richtig zu laufen, blieben erschöpft in der Mitte der Wiese vor der Ehrentribüne stehen. Und nun begann ein ohrenbetäubendes Geknalle und viele Hirsche brachen an Ort und Stelle zusammen, andere
schleppten sich noch trotz Verletzungen ins Dickicht des Waldes.
Joseph dachte, dass dies Zustände wie im Mittelalter bei den Jagden der Feudalherren wären und ihm fiel das Gedicht aus Sturm und Drang von G. A. Bürger ein:
„Wer bist du Fürst? Wer bist du, dass, durch Saat und Forst, das Hurra deiner Jagd mich treibt, entatmet, wie das Wild?“ Er liebte als Jugendlicher diese literarische Epoche des 18. Jahrhunderts
voller Gefühle und Aufbegehren. Hatte sich die Welt nicht weiterentwickelt?
Nach wenigen Minuten war der Spuk vorbei. Eine eisige Totenstille überzog die Natur.
Zur Jagd gehörte auch das Dinner im Jagdzelt. Es bestand aus erlesenen Wildspezialitäten und bot für die Teilnehmer Gelegenheit zu diskreten Geschäftsabschlüssen. Die meisten der honorigen Gäste
hatten sich schon in das grüne Jagdzelt zurückgezogen, um einen Aperitif einzunehmen.
Doch diesmal war es anders. Der kapitale ungarische Sechzehnender, den man Honecker vor die Flinte trieb und den er erlegte, war wie vom Erdboden verschwunden. Man wusste aber, dass der
Staatsratsvorsitzende alle von ihm erlegten Tiere fotografiert und kategorisiert wissen wollte und dass er dabei ein richtiger Pedant war. Oft schoss er in einer Jagdsaison mehr als hundert
Rothirsche.
Zu allem Übel waren an diesem Tag einige der Hundeführer schon zurück ins nahe Jagdhotel gefahren, denn das Gekläffe der Hunde würde die Unterhaltung stören. Es wurde langsam dunkel. Der
hektische Jagdleiter sah Lucas an Josephs Seite und bat Oberstleutnant Wild mit seinem Hund bei der Nachsuche mitzuhelfen.
Alle Hunde wurden auf der Wiese angesetzt. Die Bracken an langer Schleppleine versuchten mit tiefer Nase Spuren aufzunehmen, doch das war bei dem vorherigen Gemetzel nicht einfach, da es viele
Blutspuren gab.
Lucas richtete seine Nase in den Wind und stürmte los. Joseph folgte ihm, was bei dem Tempo des Hundes nicht einfach war.
Prompt kam der bissige Kommentar des Jagdleiters: „Der störrische Rote ist weg auf Nimmerwiedersehen!“
Auf einer Lichtung fand Joseph Lucas. Er stand regungslos vor einem Gebüsch. Von Zeit zu Zeit bellte er kurz, um seinem Herrn den Standort anzuzeigen.
Das traurige Bild, das sich Joseph bot, wird er nie vergessen. Er sah einen mächtigen Hirsch mit riesigem Geweih. Das Tier lag im hohen Gras. Als es Joseph sah, hob es seinen Kopf und blickte ihn
an. Es war ein durchdringlicher Blick eines edlen Geschöpfes, das scheinbar nicht verstand, warum die Spezies Mensch, die ihn jahrelang versorgte, heute tötete.
Als die anderen Hundeführer mit dem Jagdleiter ankamen, war der Hirsch bereits tot.
Joseph saß auf einem Baumstumpf, Lucas lag neben ihm und beide blickten in die großen Augen des Hirsches, die sich nicht schließen wollten.
Einige Wochen waren vergangen, Joseph und Lukas lebten wieder in ihrem Offizierszimmer in der Grenzkaserne, da erreichte Joseph ein Brief aus Berlin. Der Brief enthielt ein Schriftstück von dem
Jagdleiter, dem zuständigen Minister Mielke und dem Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker unterzeichnet mit folgendem Inhalt:
Der irische Setter Lukas hat durch seinen jagdlichen Einsatz bei der Nachsuche, geführt von Oberstleutnant Joseph Wild, das Waidwerk unseres Staatsratsvorsitzenden gekrönt und den kapitalsten
Hirsch, den er je erlegt hatte, durch Totverbellen angezeigt. Eine silberne Plakette an der Trophäe wird stets daran erinnern.
Ab sofort trägt der Rüde den Titel „Held der sozialistischen Arbeit“ und dieser ausgezeichnete Hund steht unter dem Schutz des Staates. Seine Ernährungs- und Tierarztkosten werden vom Staat
getragen. Die Tötung oder Verletzung des Tieres wird unter Strafe gestellt. Das beiliegende Halsband in den Staatsfarben der DDR mit dem Namen des Besitzers Genosse Oberstleutnant Wild ist ein
Beweis unserer Anerkennung.
Als am folgenden Wochenende Joseph seine Eltern besuchte und über die Auszeichnung von Lukas berichtete, amüsierte sich sein Vater prächtig. Er verneigte sich vor dem sozialistischen Helden Lucas
und sagte ihm eine glänzende kommunistische Karriere voraus.
Sonntagabend kehrte Joseph in die Grenzkaserne zurück, hängte eine Kopie der Urkunde an die Mitteilungstafel, rief anschließend die Soldaten zusammen, legte Lucas vor versammelter Mannschaft das
Halsband an und erinnerte seine Untergebenen daran, dass er erwarte, dass ab sofort seinem Hund, die Achtung zu teil werde, die ihm zusteht und er ergänzte:
„Dem Setter Lucas steht ab sofort jede Bewegungsfreiheit zu. Der Leinenzwang für den prämierten „Parteihund“ ist aufgehoben. Eine Verwechslung mit einem anderen Hund oder Wildtier ist durch das
Halsband unmöglich. Witzeleien oder Späßchen auf Kosten von Lucas bedeuten Bunker. Seine körperliche Unversehrtheit steht an erster Stelle. Zuwiderhandlungen bedeuten Militärgericht.“
Als Joseph wieder allein in seiner Stube war, musste er erst einmal kräftig lachen. Er stellte sich immer wieder die Grenzsoldaten vor, die sich seinen Vortrag mit verdutzten Gesichtern
anhörten.
Abends saß er auf seinem Wachturm und beobachtete mit seinem Fernglas die Wiesen im „Feindesland“. Und wieder sah er die junge Frau, die verzweifelt versuchte ihren Setter anzuleinen. Sie schien
auf ihn einzureden und er ließ sie auch bis auf einen Meter an sich herankommen, um dann das Weite zu suchen. Joseph amüsierte sich köstlich bei diesem Anblick und dachte nur: „Lucas würde ich
das nicht durchgehen lassen.“
Leider holten ihn in den nächsten Tagen seine selbstsicheren Gedanken ein, denn nach dem Abendspaziergang hob plötzlich Lucas seine Nase in den Wind, er schien mit seinen Lefzen die Witterung zu
kauen, er begann zu winseln und plötzlich war er verschwunden.
Joseph pfiff mit seiner Trillerpfeife, was das Zeug hielt, doch der Rotschopf war nirgends zu sehen.
Ein Stück Wild? Unwahrscheinlich, denn der gut ausgebildete Jagdhund war gehorsam und Hetzen war nicht seine Sache.
Joseph ging zum Wachturm zurück, beauftragte zwei Grenzer, die Botschaft an alle Wachsoldaten weiter zu geben, dass der „Parteihund“ Freigang habe und jeder verpflichtet sei, dafür zu sorgen,
dass dieser unbeschadet zu seinem Besitzer zurückfinde.
Er ließ sich seine Verärgerung und Enttäuschung über seinen „Streuner“ nicht anmerken, nahm sein Fernglas, um den Kontrollstreifen zu beobachten, denn an einigen Stellen des Zaunes gab es
Öffnungen zum Durchgang des Wildes. Dadurch wollte man verhindern, dass „falscher Alarm“ ausgelöst wurde.
Auf dem Kontrollstreifen war kein Hund zu sehen, aber der Anblick, der sich ihm bot, als er sein Fernglas über die Wiesen jenseits des Zaunes schweifte, ließ ihm den Atem stocken:
Zwei Setter tobten über die Wiese. Sie jagten sich gegenseitig hielten inne, legten die Vorderpfoten auf den Boden, musterten sich, um dann ihren wilden Tanz fortzuführen.
(Auf die Technik von Zeiss –Jena ist Verlass und Joseph war nah am Geschehen.)
Die Frau versuchte die Hündin am festzuhalten, was ihr nicht gelang, dann fasste sie den Rüden am Halsband, schien inne zu halten, ging in die Hocke und studierte scheinbar die Gravur.
Plötzlich lachte sie, ihr wurde scheinbar einiges klar. Im gleichen Augenblick riss sich der Rüde los, stürmte zur Hündin und dann war es geschehen. Die Frau ging zu beiden Hunden strich ihnen
mit der Hand über den Kopf und wartete geduldig bis sie sich lösten.
Sie leinte die Hündin an und ging Richtung Dorf. Beide drehten sich noch einige Male um und sahen zurück. Die vorher von Leben pulsierende Wiese war jetzt leer. Die Frau hob die Hand und winkte
Richtung Niemandsland. Es war ihr bewusst, dass diese Geste nirgends ankam.
Oder doch?
Joseph ließ sein Fernglas sinken, stieg den Wachturm hinab und traute seinen Augen nicht, denn im Gras lag ein kräftig hechelnder schuldbewusster Lucas. Er strich dem hoch dekorierten
„Republikflüchtling“ sanft über den Oberkopf, leinte ihn an und ging mit ihm in seine Stube. Lucas leerte eine Schüssel Wasser und legte sich auf seine Decke.
Joseph dachte: Leben kann so schön und ehrlich und ohne Grenzen sein. Fontane würde mit Wüllersdorf sagen: “diese Tiere sind uns über.“
Ost Berlin, die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Joseph kannte sie kaum. Vor Jahren war er einige Male bei Offizierstagungen nur kurz in Ost Berlin.
Jetzt wollte sich der Mann aus dem „Niemandsland“ einige Tage Zeit nehmen, um die Stadt mit ihren Museen und kulturellen Einrichtungen besser kennen zu lernen.
Doch gab es so viel Neues in Ost Berlin?
Auf den Straßen fuhren noch immer die gleichen Trabis und Wartburgs. Vor den Lebensmittelläden standen noch immer die Menschen Schlange. Er schlenderte über den Alexanderplatz und sah fast fünfzig, hauptsächlich Frauen, die sich in das „Centrum Warenhaus“ drängten. Neugierig folgte er der Menge und stellte fest, dass es um nichts Weiteres als Bananen ging.
In einem Café in der Nähe wollte er eine Berliner Weiße trinken, als er plötzlich von zwei Polizisten in Zivil gebeten wurde, sich auszuweisen. Er schob seinen Offiziersausweis hin, die beiden entschuldigten sich und verschwanden. Wahrscheinlich tun sie nur ihre Pflicht dachte er, und dennoch überkam ihn ein leichtes Unbehagen.
An den Schaukästen der Kinos gab es Plakate mit Westfilmen und Sergio Leones „Es war einmal in Amerika“ war der große Renner.
An der Kasse des Berliner Ensembles wollte er seine Karte für die „Galilei Aufführung“, die auf dem Offizierskontigent hinterlegt war, abholen. Seine Enttäuschung war groß, als ihm eine junge hübsche Frau an der Kasse erklärte, dass „Galilei“ durch das Lehrstück „Die Tage der Kommune“ ausgetauscht wurde. Darauf hatte er keine große Lust. Als die Kassiererin seine Enttäuschung merkte, riet sie ihm, im Palast der Republik das „Festival des politischen Liedes“ zu besuchen. Sie könnte für ihn an der Kasse eine Karte zurücklegen lassen .Das Konzert sei etwas ganz Besonderes und sie flüsterte ihm die Namen Udo Lindenberg und Harry Belafonte ins Ohr.
Ihre Nähe faszinierte ihn und er sagte spontan: „Wenn sie mich begleiten, bin ich bereit.“ Darauf war die junge Frau wahrscheinlich nicht gefasst und sie überlegte kurz, tätigte einen Anruf und stimmte zu. Später sagte sie ihm, dass es für sie als seine Begleitung eine einmalige Chance war, diese Veranstaltung zu besuchen, denn es war bekannt, dass das Publikum nur aus jungen Funktionären und Offizieren bestand. Diese wurden mit Bussen angekarrt, die sich auf dem Parkplatz brav aneinanderreihten.
Sie trafen sich am Abend im Foyer des Palastes der Republik. Joseph war von der Eleganz und dem Ambiente beeindruckt: Teure Ledersessel mit jungen knutschenden Menschen, aber auch einige „ältere Semester“ waren darunter.
Udo Lindenberg bemühte sich mit seinen pazifistischen Texten und seiner rauchigen Stimme ein Zeichen für den Frieden zu setzen und die jungen Menschen zu bewegen, was ihm kaum gelang.
Enttäuscht verließ er bei artigem Applaus die Bühne. Die Reaktion des Publikums war für Oberstleutnant Joseph selbstverständlich, da er dieses eifrige Klatschen von vielen Veranstaltungen kannte. Seine Begleiterin schien mehr erwartet zu haben. Ihre Unzufriedenheit ließ Joseph vorsichtig werden. War es vielleicht eine Genossin, die ihn unter die Lupe nehmen sollte. Er wurde etwas eintönig. Daraufhin verschwand sie auch schnell mit der Begründung, ihre Tochter, die sie vorher nicht erwähnte, würde auf sie warten.
Am nächsten Morgen wollte Joseph seinen Studienfreund Egon Schramm, der in einer Offizierswohnung in der Bouchéstraße untergebracht war und am Brandenburger Tor die Plattform für Staatsgäste mit seinen Grenzsoldaten überwachte, besuchen.
Da er Egon nicht zu Hause antraf, beschloss er seinen Freund an seinem Arbeitsplatz zu überraschen. Er schlenderte auf das Brandenburger Tor zu und hielt Ausschau nach den Grenzsoldaten.
Plötzlich wurde er von zwei Männern in Zivil zu Boden gerissen und eine Maschinenpistole zielte auf seinen Kopf. Er hörte, wie einer der Beamten die Meldung weiter gab: „Republikflüchtiger Zivilist am Brandenburger Tor gefasst.“ Er wurde auf den Rücken gedreht und durchsucht. Einer der Männer zog Josephs Offiziersausweis hervor und stand plötzlich stramm: „Entschuldigen sie bitte, Herr Oberstleutnant, es war ein Versehen, wir haben Sie für eine Zivilperson gehalten und sie kennen ja die Anordnungen.“ In der Zwischenzeit war auch Egon zur Stelle und lachte sich krank. „Alter Freund, hier stolziert man nicht mit grauem Mantel lässig durch die Gegend, das kannst du in deinem „Niemandsland“ tun, sagte er.
Joseph wischte sich den Schmutz von den Kleidern und murmelte nur: „Wozu diese rohe Gewalt, ich hätte mich ausweisen können.“ Verstört drehte er sich um und ging.
„Ich habe gleich Dienstschluss, lass uns ein Bier trinken, du Spielverderber“, rief ihm Egon nach. Joseph ging weiter, so als hätte er den Vorschlag seines Freundes nicht vernommen. Er murmelte weiter vor sich hin: “Wozu diese rohe Gewalt?“
Am gleichen Abend fuhr er zu seinen Eltern zurück. Er sprach kein Wort. Er zog sich in sein Zimmer zurück, Lucas folgte ihm.
Als seine Mutter später nach ihm sah, saß er auf dem Bett und streichelte Lukas über den Oberkopf. Er sah sie traurig an und sagte nur: „Bis heute habe ich gedacht, wir tun das Richtige“.
Die folgenden Wochen verbrachte Oberstleutnant Joseph Wild wieder in der Kaserne und er war froh, dass es an der Grenze keine Zwischenfälle gab.
Bei seinen, bei den Grenzsoldaten gefürchteten, Politabenden mit Frage-Antwort-„Spiel“ ertappte er sich immer wieder, dass er in seinem Kopf die stereotypen Formulierungen hinterfragte. Selbst Lucas merkte, dass Joseph nicht ganz bei der Sache war und er wurde immer „eigenständiger“ und büxte auch manchmal aus. Sein Besitzer ließ es ihm durchgehen, denn Lucas „Parteihalsband“ war der Garant für dessen Unversehrtheit. Als er an einem Herbsttag aber mehr als eine Stunde wegblieb, wurde Joseph unruhig. Er nahm sein Fernglas und begab sich auf den Grenzturm, um nach dem Ausreißer Ausschau zu halten.
Er traute seinen Augen nicht. Auf der Wiese im „Feindesland“ tobte eine Horde Setterwelpen und dazwischen erspähte er Lucas, der sie kräftig aufmischte. Eine junge Frau warf bunte Bälle durch die Gegend und sie schien viel Spaß zu haben. Neben ihr stand ein erwachsener Setter, bestimmt die Mutter der kleinen Rabauken, die scheinbar von dem bunten Treiben wenig hielt oder einfach nur ihre Atempause genoss.
Joseph lächelte vor sich hin, vielleicht beneidete er Lucas auch. Dieser schlaue Hund ignorierte die von Menschen aufgetürmten Grenzzäune, er genoss seine Freiheit im Kreise seiner ungestümen Kinder. Und Joseph war glücklich, als er sah, dass diese junge Frau Lucas über sein seidenes Haar strich. Wie gerne wäre er an dessen Stelle gewesen.
Und wieder kamen diese Kindheitserinnerungen auf und Joseph wusste nicht ob sie schön oder schmerzhaft waren.
Manchmal dachte Joseph auch darüber nach wie sein Leben verlaufen wäre, wenn man ihm erlaubt hätte seinen Neigungen zu folgen und Literatur zu studieren: Lessing, Heine, Goethe Schiller, Hölderlin, Rilke, Hesse, Thomas Mann. Wie wären wohl diese großen Männer mit diesen grauen Grenzzäunen umgegangen?
Hätten sie sich auch einem politischen System untergeordnet und Geschichten über Entenzucht in der LPG verfasst oder Hymnen an einen Traktor geschrieben?
Vielleicht auch wären sie in die „innere Emmigration“ gegangen, wahrscheinlicher aber ist, dass sie sich gewehrt hätten.
Weihnachten verbrachte Joseph dieses Jahr bei seinen Eltern. Er und Lucas begleiteten seinen Vater zur Jagd. Verwundert blickte der Vater Joseph an, da dieser keine Lust hatte eine Büchse mitzunehmen. „Du triffst für uns beide und außerdem trage ich schon mein halbes Leben im Dienst Waffen mit mir herum. Dir als Sonntagsschütze, der für den Weihnachtsbraten zuständig ist, sei sie gegönnt “, meinte dieser.
Schnippisch erwiderte der Vater, dass bei solch einem hoch dekorierten Parteihund auch seine eigene Büchse überflüssig sei, da Lucas bestimmt das Wild allein erledigen und anschließend ein Freudengebell auf die SED Führung anstimmen wird.
Die Jagd war erfolgreich und natürlich trug Lucas seinen Teil dazu bei.
Auch dieses Jahr gab es einen Rehbraten mit böhmischen Knödel und Rotkraut und zum Nachtisch nach einem Familienrezept aus der Heimat der Mutter.
Kurz nach Mitternacht wurden alle Tiere im Stall gefüttert und die Hunde erhielten auch ein Stück Braten. Diese alte Tradition versinnbildlichte den Respekt, den man als Mensch allen Lebewesen schuldet, erklärte ihm einmal der Vater.
Unwillkürlich fragte sich Joseph: „Und wo bleibt die Achtung vor dem Menschen?“ Und wieder mal musste er an die Demütigung am Brandenburger Tor denken.
Den Silvesterabend verbrachte der Hagestolz in der Grenzkaserne. Bei den Grenzoffizieren lagen an solchen Tagen die Nerven blank, denn häufig flogen die Böller aus dem Westen über die Mauer und lösten Alarm aus. Trotz striktem Alkoholverbot waren manche der Soldaten angetrunken und so unberechenbar.
An diesem Abend gab es keine besonderen Vorkommnisse und Oberstleutnant Wild übergab die Aufsicht an einen zuverlässigen Untergebenen, nahm Lucas an die Leine und zog sich in der Hoffnung, dem derben Ess- und Schweißgeruch zu entgehen, auf den Kontrollturm zurück.
Die frische Luft tat ihm gut. Das Knallen mochte er nicht, dennoch störte es ihn wenig, eine ähnliche Geräuschkulisse kannte er vom Schießstand. Obwohl auch in der DDR Böller wie „Filou“ oder „Blitzschläge“ im Handel angeboten wurden, war in Josephs Elternhaus die Begeisterung dafür gering.
Die Mutter bedauerte die armen Wildtiere, die aufgescheucht wurden und dann umherirren und der Vater erinnerte sich dabei an die grausamen Raketen über den Schützengräben.
„An manchen Fassaden der Häuser sind noch die Einschusslöcher des Krieges zu sehen und sie „üben“ schon für den nächsten und „pulvern“ das Geld in die Luft. Eine Flasche Rotwein ist mir lieber“, meinte der Vater.
An diesem Abend war es an der Grenze fast still, verglichen mit den Jahren davor. Auch der Westen „protzte“ dieses Jahr nicht mit neuesten amerikanischen Importböllern.
Josephs Blick streifte über die Wipfel der Bäume, während seine Hand über Lucas Rücken glitt. Er fühlte sich wohl hier oben mit seinem Hund weit weg von dieser verrückten Realität.
Doch plötzlich wurde er hellwach. Was war das? Unzählige Wunderkerzen leuchteten auf der Wiese gegenüber der Grenze auf. Kreise in der dunklen Nacht, Linien. Eine Sprühkerze hüpfte auf und nieder und zeichnete ein „M“ in die Winternacht.
„Marie“ sagte Joseph halblaut. Er lächelte vor sich hin.
Als Kind hatte er einmal am Silvesterabend sich aus dem Haus geschlichen und vor Maries Fenster viele Wunderkerzen, das einzige Feuerspektakel, das der Vater erlaubte, zum Sprühen gebracht.
Marie öffnete das Fenster und winkte ihm kurz zu und er war überglücklich.
„Damals war die Welt noch in Ordnung“, sagte er traurig zu Lucas.
Im folgenden Frühjahr kam Bewegung in das Grenzgebiet. Oberstleutnant Wild war damit beschäftigt den Abbau der Selbstschussanlagen zu überwachen. Anschließend kamen Spezialisten, um die vergrabenen Minen zu entsichern und abzutransportieren.
Joseph strich Lucas übers Fell und flüsterte ihm zu:“ Das tun sie für dich, du Grenzgänger. Du musst dich schon entscheiden: pflichtbewusster Parteihund oder Liebhaber der „Wessi - Setter“-Hündinnen. Könntest du lesen, wüsstest du, dass es seit letztem Jahr die Verordnung zur Familienzusammenführung zwischen Ausländern und DDR-Menschen gibt. Und du bist doch ein Mensch und kein Hund bei deinen hohen Ehrungen. Und du bist ja auch manch einem „homo sapiens“ überlegen, denn du kapierst schneller als mancher Zweibeiner und bist treuer und weniger verlogen.“
Der alte Wild konnte seinem Sohn aber die wahren Gründe für die Grenzumbauten nennen:
„Ein Milliardenkredit, den der gewiefte Schalk und der dicke Bayer Franz Joseph ausgehandelt haben, lässt Wunder geschehen. Scheinbar pfeifen wir aus dem letzten Loch und brauchen die Hilfe des „Klassenfeindes“, meinte er.
Joseph war mal wieder erstaunt über die Informationsquellen seines Vaters, welche dieser auch seinem Sohn nie preisgab. Die Verbindungen des alten „Fuchses“ schienen aber weit nach oben zu reichen.
An einem verregneten Abend machte Oberstleutnant Wild nur widerwillig seinen letzten Kontrollgang. Er forderte Lucas auf ihn zu begleiten, doch dieser rollte sich auf seiner Decke zusammen und tat so als würde er schlafen. „Faulpelz“ schimpfte Joseph und er verließ allein die Stube.
Als er gerade dabei war, missmutig die Außentür der Kaserne zu öffnen, wurde er aus seiner Lethargie gerissen. Eine Leuchtrakete bohrte sich in ungefähr 200 Meter Entfernung in den Himmel. Es folgte ein ohrenbetäubendes Sirenenheulen. Joseph drückte den Alarmknopf und ließ die Mannschaft antreten.
Es dauerte nicht lange, da tauchten zwei Grenzsoldaten auf, die eine weinende Frau vor sich her schubsten. Sie war durchnässt und beteuerte immer wieder: „ Ich habe doch nur diesen kleinen Ausreißer gesucht“. In ihrem Arm hielt sie ein kleines nasses fiependes Bündel.
„Nenne uns sofort deine Helfer, wenn wir sie finden, werden wir sie erschießen“, brüllte Feldwebel Schneider, der für seine Linientreue bekannt war. Er war euphorisch und überdreht. Er stieß die Frau wieder nach vorne. Das Bündel glitt ihr aus dem Arm und ein durchnässter kleiner Setter fiel zu Boden.
Der Feldwebel holte in seiner Rage aus, um dem kleinen Hund einen Tritt zu verpassen. Blitzschnell verbiss sich Lucas, dessen Anwesenheit bis jetzt niemandem aufgefallen war, im Bein des wütenden Grenzers. Dieser zog seine Waffe, um auf Lucas zu schießen.
Joseph, der bis jetzt wie gelähmt dastand, erkannte die Gefahr für Lucas. Er schlug dem Feldwebel die Waffe aus der Hand und sagte mit zitternder Stimme zu seinen stellvertretenden Offizier: „Genosse, bringen Sie den Lümmel in den Bau. Er war anwesend, als ich der Kompanie mitteilte, dass dieser Hund durch seine besonderen Verdienste den Schutz von oberster Stelle genießt. Und führt die Frau zum Verhör in meine Stube. Ich will nicht gestört werden. Ein Posten soll vor meiner Tür Stellung beziehen.“
In der Zwischenzeit waren für Joseph die Zusammenhänge klar und er wunderte sich selbst über die Ruhe, die von ihm ausging.
Als er mit der Frau allein war, bot er ihr einen Stuhl an und sagte mit zitternder Stimme: „Sie sind doch Marie, Sie haben mich bestimmt auch erkannt, ich bin Joseph. Sie nickte.
Er ging an seinen Schrank suchte ein sauberes Hemd sowie eine Sporthose und Socken, legte alles aufs Bett und sagte:
„Ich muss einen klaren Kopf bekommen und telefonieren, ich bin gleich wieder hier. Es wird Sie niemand stören. Diese Kleidungsstücke sind zwar nicht in ihrer Größe, aber sie sind trocken.“
Der kleine Setter hatte sich auf Lucas Hundebett breit gemacht und war dabei das eine Ende der Decke anzunagen. Lucas lag daneben und er beobachtete ihn voller Bewunderung.
Als Joseph zur Tür ging, sah er, dass Marie heimlich versuchte ihre Tränen wegzuwischen.
„Marie, ich habe dich immer beschützt vor den Wespen auf dem Obstkuchen meiner Mutter, dem Truthahn der Nachbarn, dem fauchenden Kater, den Jungs, die dich mit Schneebällen bewarfen und später in Gedanken vor allem Bösen. Das habe ich deinem Vater versprochen. Ich werde es immer tun, auch jetzt.“
„Danke, Joseph“, sagte sie und trocknete ihr nasses Haar mit einem Handtuch, das auch auf dem Bett bereitlag.
Joseph ging in sein Dienstzimmer , er rief seinen Vater an und schilderte ihm den Vorfall. Dieser war lange sprachlos, so dass Joseph die Stille unheimlich wurde.
Dann sprach er leise und bestimmt: „Du tust gar nichts und du hälst Marie von allem und allen fern. Ich erledige das bis morgen früh.“
Joseph kehrte in sein Zimmer zurück, Marie hatte die trockenen Kleider angezogen und die nassen auf die Heizung gelegt. Als er eintrat, war sie dabei Lucas zu streicheln. Joseph legte seine Dienstjacke ab.
Jetzt saßen sie sich gegenüber, die junge Frau und der Mann aus zwei verschiedenen Hemisphären und sie sahen sich schweigend an, die Kinder von einst.
Joseph stellte zwei Tassen Tee auf den Tisch. Ihre Augen trafen sich; Wehmut, Trauer, Sehnsucht nach einer Welt, die es nicht gab.
Im Morgengrauen fuhr ein Wagen vor. Ein elegant gekleideter Mann sprang heraus, nachdem sein Fahrer ihm die Tür öffnete. Er legte sofort mit polternder Stimme und russischen Kraftausdrücken los:
„Wer hat es gewagt meine Agentin zu verhaften, Oberstleutnant Wild, das wird für Sie Konsequenzen haben. Ich werde Ihren General informieren. Bringen Sie die Dame sofort in mein Fahrzeug und den Hund, welchen sie als Tarnung dabei hatte, ebenfalls. Oberstleutnant, Sie werden mich begleiten.
In der Zwischenzeit war das Grenzregiment angetreten. Alle standen eingeschüchtert in Reih und Glied. Nur einer wagte zu flüstern: “ Jetzt hat der Wild es endgültig versch…“
Joseph hörte den Kommentar, verzog aber keine Mine. Er nahm auf dem Rücksitz des Wagens neben Marie Platz. Im Fußraum lag der kleine Setter, der aufmüpfig an Josephs Stiefel nagte. Wahrscheinlich wäre er lieber bei seinem Vater Lucas geblieben.
Der Wagen fuhr los und keiner sprach ein Wort.
Sie fuhren über holprige Straßen die Grenze entlang. Als Joseph den kleinen Setter dezent vom Nagen seines Schuhwerks abhalten wollte, traf seine Hand auf die von Marie, die auf dem Rücken des Hundes lag. Die beiden Hände verkrampften sich ineinander. Die Zeit schien plötzlich still zu stehen.
Sie fuhren an eine der geheimen, sogenannten operativen Grenzschleusen, die vom Zentralkomitee der SED eingerichtet wurden, um Funktionäre in beide Richtungen zu schleusen und die auch Agenten des Warschauer Pakts zur Verfügung standen.
Der Russe verschwand mit Marie und dem Welpen in einer überdimensionalen Betonröhre und kehrte kurz danach allein zurück.
Eine Stunde später hielt der Wagen wieder vor der Kaserne, Joseph stieg aus, murmelte „spasiba“ und obwohl Lucas ihn freudig begrüßte, empfand er eine große unerträgliche Leere in seinem Inneren.
Er versuchte seine Stube aufzuräumen. In den noch nassen Handtüchern, in seinen Kleidungsstücken, die er am Abend davor Marie zurechtlegte, überall war noch ihr Duft zu spüren. Der muffige Geruch seines Kasernenzimmers war verschwunden.
„So muss das wahre Leben sein, so wird es sich anfühlen“, dachte er.
Für einen Augenblick war er glücklich.
Im folgenden Frühjahr kam Bewegung in das Grenzgebiet. Oberstleutnant Wild war damit beschäftigt den Abbau der Selbstschussanlagen zu überwachen. Anschließend kamen Spezialisten, um die vergrabenen Minen zu entsichern und abzutransportieren.
Joseph strich Lucas übers Fell und flüsterte ihm zu:“ Das tun sie für dich, du Grenzgänger. Du musst dich schon entscheiden: pflichtbewusster Parteihund oder Liebhaber der „Wessi - Setter“-Hündinnen. Könntest du lesen, wüsstest du, dass es seit letztem Jahr die Verordnung zur Familienzusammenführung zwischen Ausländern und DDR-Menschen gibt. Und du bist doch ein Mensch und kein Hund bei deinen hohen Ehrungen. Und du bist ja auch manch einem „homo sapiens“ überlegen, denn du kapierst schneller als mancher Zweibeiner und bist treuer und weniger verlogen.“
Der alte Wild konnte seinem Sohn aber die wahren Gründe für die Grenzumbauten nennen:
„Ein Milliardenkredit, den der gewiefte Schalk und der dicke Bayer Franz Joseph ausgehandelt haben, lässt Wunder geschehen. Scheinbar pfeifen wir aus dem letzten Loch und brauchen die Hilfe des „Klassenfeindes“, meinte er.
Joseph war mal wieder erstaunt über die Informationsquellen seines Vaters, welche dieser auch seinem Sohn nie preisgab. Die Verbindungen des alten „Fuchses“ schienen aber weit nach oben zu reichen.
An einem verregneten Abend machte Oberstleutnant Wild nur widerwillig seinen letzten Kontrollgang. Er forderte Lucas auf ihn zu begleiten, doch dieser rollte sich auf seiner Decke zusammen und tat so als würde er schlafen. „Faulpelz“ schimpfte Joseph und er verließ allein die Stube.
Als er gerade dabei war, missmutig die Außentür der Kaserne zu öffnen, wurde er aus seiner Lethargie gerissen. Eine Leuchtrakete bohrte sich in ungefähr 200 Meter Entfernung in den Himmel. Es folgte ein ohrenbetäubendes Sirenenheulen. Joseph drückte den Alarmknopf und ließ die Mannschaft antreten.
Es dauerte nicht lange, da tauchten zwei Grenzsoldaten auf, die eine weinende Frau vor sich her schubsten. Sie war durchnässt und beteuerte immer wieder: „ Ich habe doch nur diesen kleinen Ausreißer gesucht“. In ihrem Arm hielt sie ein kleines nasses fiependes Bündel.
„Nenne uns sofort deine Helfer, wenn wir sie finden, werden wir sie erschießen“, brüllte Feldwebel Schneider, der für seine Linientreue bekannt war. Er war euphorisch und überdreht. Er stieß die Frau wieder nach vorne. Das Bündel glitt ihr aus dem Arm und ein durchnässter kleiner Setter fiel zu Boden.
Der Feldwebel holte in seiner Rage aus, um dem kleinen Hund einen Tritt zu verpassen. Blitzschnell verbiss sich Lucas, dessen Anwesenheit bis jetzt niemandem aufgefallen war, im Bein des wütenden Grenzers. Dieser zog seine Waffe, um auf Lucas zu schießen.
Joseph, der bis jetzt wie gelähmt dastand, erkannte die Gefahr für Lucas. Er schlug dem Feldwebel die Waffe aus der Hand und sagte mit zitternder Stimme zu seinen stellvertretenden Offizier: „Genosse, bringen Sie den Lümmel in den Bau. Er war anwesend, als ich der Kompanie mitteilte, dass dieser Hund durch seine besonderen Verdienste den Schutz von oberster Stelle genießt. Und führt die Frau zum Verhör in meine Stube. Ich will nicht gestört werden. Ein Posten soll vor meiner Tür Stellung beziehen.“
In der Zwischenzeit waren für Joseph die Zusammenhänge klar und er wunderte sich selbst über die Ruhe, die von ihm ausging.
Als er mit der Frau allein war, bot er ihr einen Stuhl an und sagte mit zitternder Stimme: „Sie sind doch Marie, Sie haben mich bestimmt auch erkannt, ich bin Joseph. Sie nickte.
Er ging an seinen Schrank suchte ein sauberes Hemd sowie eine Sporthose und Socken, legte alles aufs Bett und sagte:
„Ich muss einen klaren Kopf bekommen und telefonieren, ich bin gleich wieder hier. Es wird Sie niemand stören. Diese Kleidungsstücke sind zwar nicht in ihrer Größe, aber sie sind trocken.“
Der kleine Setter hatte sich auf Lucas Hundebett breit gemacht und war dabei das eine Ende der Decke anzunagen. Lucas lag daneben und er beobachtete ihn voller Bewunderung.
Als Joseph zur Tür ging, sah er, dass Marie heimlich versuchte ihre Tränen wegzuwischen.
„Marie, ich habe dich immer beschützt vor den Wespen auf dem Obstkuchen meiner Mutter, dem Truthahn der Nachbarn, dem fauchenden Kater, den Jungs, die dich mit Schneebällen bewarfen und später in Gedanken vor allem Bösen. Das habe ich deinem Vater versprochen. Ich werde es immer tun, auch jetzt.“
„Danke, Joseph“, sagte sie und trocknete ihr nasses Haar mit einem Handtuch, das auch auf dem Bett bereitlag.
Joseph ging in sein Dienstzimmer , er rief seinen Vater an und schilderte ihm den Vorfall. Dieser war lange sprachlos, so dass Joseph die Stille unheimlich wurde.
Dann sprach er leise und bestimmt: „Du tust gar nichts und du hälst Marie von allem und allen fern. Ich erledige das bis morgen früh.“
Joseph kehrte in sein Zimmer zurück, Marie hatte die trockenen Kleider angezogen und die nassen auf die Heizung gelegt. Als er eintrat, war sie dabei Lucas zu streicheln. Joseph legte seine Dienstjacke ab.
Jetzt saßen sie sich gegenüber, die junge Frau und der Mann aus zwei verschiedenen Hemisphären und sie sahen sich schweigend an, die Kinder von einst.
Joseph stellte zwei Tassen Tee auf den Tisch. Ihre Augen trafen sich; Wehmut, Trauer, Sehnsucht nach einer Welt, die es nicht gab.
Im Morgengrauen fuhr ein Wagen vor. Ein elegant gekleideter Mann sprang heraus, nachdem sein Fahrer ihm die Tür öffnete. Er legte sofort mit polternder Stimme und russischen Kraftausdrücken los:
„Wer hat es gewagt meine Agentin zu verhaften, Oberstleutnant Wild, das wird für Sie Konsequenzen haben. Ich werde Ihren General informieren. Bringen Sie die Dame sofort in mein Fahrzeug und den Hund, welchen sie als Tarnung dabei hatte, ebenfalls. Oberstleutnant, Sie werden mich begleiten.
In der Zwischenzeit war das Grenzregiment angetreten. Alle standen eingeschüchtert in Reih und Glied. Nur einer wagte zu flüstern: “ Jetzt hat der Wild es endgültig versch…“
Joseph hörte den Kommentar, verzog aber keine Mine. Er nahm auf dem Rücksitz des Wagens neben Marie Platz. Im Fußraum lag der kleine Setter, der aufmüpfig an Josephs Stiefel nagte. Wahrscheinlich wäre er lieber bei seinem Vater Lucas geblieben.
Der Wagen fuhr los und keiner sprach ein Wort.
Sie fuhren über holprige Straßen die Grenze entlang. Als Joseph den kleinen Setter dezent vom Nagen seines Schuhwerks abhalten wollte, traf seine Hand auf die von Marie, die auf dem Rücken des Hundes lag. Die beiden Hände verkrampften sich ineinander. Die Zeit schien plötzlich still zu stehen.
Sie fuhren an eine der geheimen, sogenannten operativen Grenzschleusen, die vom Zentralkomitee der SED eingerichtet wurden, um Funktionäre in beide Richtungen zu schleusen und die auch Agenten des Warschauer Pakts zur Verfügung standen.
Der Russe verschwand mit Marie und dem Welpen in einer überdimensionalen Betonröhre und kehrte kurz danach allein zurück.
Eine Stunde später hielt der Wagen wieder vor der Kaserne, Joseph stieg aus, murmelte „spasiba“ und obwohl Lucas ihn freudig begrüßte, empfand er eine große unerträgliche Leere in seinem Inneren.
Er versuchte seine Stube aufzuräumen. In den noch nassen Handtüchern, in seinen Kleidungsstücken, die er am Abend davor Marie zurechtlegte, überall war noch ihr Duft zu spüren. Der muffige Geruch seines Kasernenzimmers war verschwunden.
„So muss das wahre Leben sein, so wird es sich anfühlen“, dachte er.
Für einen Augenblick war er glücklich.
An einem der folgenden Tage kam der Mann in dem schwarzen Wolga erneut bei Josephs Vater vorbei.
Nachdem sie drei Becher Wodka geleert hatten, sagte der Russe in seinem ulkigen Deutsch: „Grenze ist Problem für Sohn. Neue Rabota für Major Wild Schreibtisch in Erfurt.“
Die Versetzung ließ nicht lange auf sich warten. Seine neue Dienststelle war das Grenzkommando Süd in Erfurt. Natürlich wurde Joseph gleichzeitig für seine „Verdienste für die sowjetische Brudernation“ zum Major befördert. An seiner Tür wurde ein glänzendes Messingschild „Stellvertretender Dienstellenleiter Genosse Major Wild“ angebracht.
Auf seinem Tisch häuften sich Akten, die er „gelegentlich“ durchsehen sollte. Unter seinem Tisch in einem bequem gepolsterten Weidenkorb ruhte Lukas. Sein Parteihalsband zeigte Abnutzungsspuren, seine Lefzen und seine Augenbraun hatten ihr dunkles Braun verloren und ein weißgrauer Schleier auf dem Nasenrücken verlieh ihm die Überlegenheit und Würde eines alten Herren, der voller Stolz sein Leben gemeistert hat.
Besonders freute er sich auf die Spaziergänge im ega-Park oder im nahen Steigerwald. An sonnigen Tagen ging es manchmal nach Dienstschluss in den Zoopark. Besonders die Voliere mit den Fasanen hatte es Lucas angetan. Bei dem kleinsten Hauch von Wildduft verharrte Lucas für Minuten in seiner für Vorstehhunde typischen Pose. Menschen, oft Kinder, blieben bei dieser außergewöhnlichen Vorstellung stehen und Joseph dozierte jedes Mal, dass dies die Achtung vor einer anderen Kreatur sei, die bei uns Menschen oft abhandengekommen ist.
Die Jahre vergingen.
Den Urlaub verbrachte Joseph bei seinen Eltern. Er begleitete seinen Vater bei seinen Reviergängen und wenn Lucas einem Fasan vorstand und dieser mit einem empörten Schrei hochging, ließ der alte Mann die Flinte sinken und sagte etwas lakonisch: „Ich habe gedacht, es sei eine Henne und weibliches Wild hat bei mir das ganze Jahr Schonzeit.“ Aber auch manch kapitalen Rehbock ließ er weiterziehen mit der Begründung, dass er keine Berechtigung habe, der Natur solch ein Prachtwerk zu entnehmen.
Joseph lächelte vor sich hin, doch Lucas „verstand die Welt nicht mehr“, schließlich war er ein „hochdekorierter“ Jagdhund.
Der alte Wild lästerte dann: „Lucas, du hältst dich gut, wahrscheinlich überlebst du deinen Gönner Honi, dem es bald an den Kragen gehen wird.“
Dabei vermieden es Vater und Sohn über Politik zu sprechen und wenn sie es doch taten, hatte scheinbar jeder das Gefühl, sich vor dem anderen rechtfertigen zu müssen, warum er zu einem Teil dieses Systems, das sich in Auflösung befand, geworden war.
Die hohlen Reden von Honecker, Mielke und Krenz waren ihnen genau so fremd wie die Losungen der Montagsdemonstrationen: “Wir sind das Volk“.
„Sind auch wir das Volk?“, fragte eines Abends Joseph ironisch seinen Vater. Dieser zuckte die Achseln.
Eines Morgens beim Frühstück sagte die Mutter ganz plötzlich: „Wie ihr wisst, habe ich es bis jetzt abgelehnt in meine alte Heimat zu reisen, jetzt verspüre ich aber ein Bedürfnis endgültig Abschied zu nehmen und noch einmal die Luft unserer Felder zu atmen und die Sonne hinter dem Hügel in Böhmen aufgehen zu sehen.“ Joseph war bereit, den Wunsch der Mutter zu erfüllen und einige Tage später fuhren Mutter und Sohn, natürlich war auch Lucas dabei, los.
Sie übernachteten in Prag und fuhren am nächsten Morgen nach Wahlburg zu einem kleinen
Dorf mit einem tschechischen Ortsschild. Sie standen vor einem Haus, das mit einer gelblichen Farbe, die an manchen Stellen abblätterte, notdürftig gestrichen war.
Das alte Tor zierte noch immer das bronzene Schild, das der Großvater in Prag anfertigen ließ: ein Setter in Vorstehpose mit der Innschrift:“ Hier wache ich“. Der Glanz war verblichen, es war durch die vielen kalten Winter stumpf geworden.
Eine Frau, die im Garten Unkraut jätete, bemerkte die beiden und kam auf sie zu.
Zuerst beäugte sie das fremde Auto, dann zeigte sie auf Lucas und auf das Schild am Hoftor und sagte in einem gebrochenen Deutsch: „gleiche Hund, ich liebe Hunde“. Sie streichelte Lucas zärtlich über den Rücken.
Die tschechische Frau glaubte zuerst, dass auch sie in die deutsche Botschaft nach Prag wollten.
Joseph gelang es, der Frau verständlich zu machen, dass dies das Elternhaus seiner Mutter sei und diese das Bedürfnis hatte, das alles noch einmal zu sehen. Die Mutter stand wortlos da mit feuchten Augen, den Blick in die Ferne auf die Hügel gerichtet.
Die fremde Frau verstand nicht, was sich hier abspielte, dennoch war sie ergriffen und bat die beiden ins Haus.
Josephs Mutter bedankte sich freundlich, bat Joseph aber sie nach Hause zu fahren. Auf der Fahrt zurück sagte sie zu ihrem Sohn: „Jetzt konnte ich Abschied nehmen, danke, dass du mich begleitet hast.“
Eines Abends, als sie alle im elterlichen abhörsicheren „Schlafzimmerbunker“ saßen und das Westfernsehn eingeschaltet hatten, klopfte es an der Tür. Der Vater war aufgescheucht, machte den Fernseher aus und ging zur Tür.
Draußen stand der russische Diplomat, er war in Eile: „Friedrich, mein Freund, ich komme um Daswidanie zu sagen, ich muss zurück nach Moskau, Konetz , Ende aus. Du warst viele Jahre mein Freund, Gorbatschov wird euch die Freiheit geben, ich weiss es.“ Wie immer tranken sie ein Glas Wodka auf der Terrasse und der Russe verschwand wieder in der Dunkelheit.
In der Folgezeit überschlugen sich die Ereignisse und die Medien in Ost und West strengten sich an, um bei der Berichterstattung mithalten zu können:
Joseph staunte, denn der Schießbefehl, denn es ja offiziell nie gab, wurde aufgehoben. Er musste an die junge Frau denken, die vor seinen Augen verblutete.
Ungarische Grenzer bauten an der Grenze zu Österreich den Stacheldraht ab.
Tausende brave DDR Bürger flohen über Ungarn und die Tschechoslowakei in die Bundesrepublik.
In Leipzig gingen die Menschen zu Tausenden auf die Straße Er sah in den Fernsehnachrichten die Bilder von Menschenmassen, die den Grenzübergang Bornholmer Straße überqueren und die Berichte von feiernden Menschen am Brandenburger Tor.
Und Major Joseph Wild, ließ ihn das alles kalt?
Bestimmt nicht, aber er war heimatlos geworden, genau wie seine Mutter damals. Diese floh Richtung Deutschland und er floh nun in seine innere Welt, die recht klein war. Er tat das, was er schon immer tun wollte. Er begann zu schreiben über grüne Wiesen, die Sonne am Morgen, den Gesang des Rotkehlchens, das Schreien der Wildgänse, die frei durch die Welt ziehen. Innere Emigration nannte man das bei Schriftstellern, die sich im Dritten Reich in sich selbst zurückzogen, weil sie nicht dazugehören wollten.
Für Joseph hatte sich alles verändert und er war müde, genau wie Lucas, den er an manchen Tagen richtig überreden musste seinen weichen Korb zu verlassen.
War das DDR-Regime gut? Bestimmt nicht.
Ist das, was jetzt auf die Menschen zukam besser? Er wusste es nicht, es war eine Welt, die man ihm Jahrzehnte als Feindbild schilderte. Sollte er sich plötzlich in dieser neuen Welt wohlfühlen?
Als er wieder in Erfurt war, wurde Major Wild von Generalmajor Teichmann beauftragt, den Abbau der Grenzanlagen zu überwachen.
Joseph schrieb einen Brief an Minister Eppelmann mit folgendem Inhalt:
„Sehr geehrter Herr Minister,
Ich habe die 1510 km lange Grenze nicht gebaut. Ich wollte sie nicht. Sie hat mich von lieben Menschen getrennt. Ich hatte aber auch nicht den Mut, den Staat und seinen Stacheldraht zu hinterfragen. Sollen diejenigen, die diese monströsen Abtrennungen errichtet haben, sie auch abtragen. Bitte nehmen sie meine Kündigung an. Hochachtungsvoll, Joseph Wild .“
Danach fuhr er mit Lucas zu seinen Eltern zurück. Er spielte mit seinem Vater Schach und half der Mutter im Garten, bis plötzlich ein Anruf seine Gedanken durcheinanderwirbelte.
Marie bat ihn um ein Treffen in Oberberg.
Er hatte sich vorgenommen den Westen nie zu betreten, doch das alles war jetzt nicht mehr wichtig.
Er nahm Lucas an die Leine, hob den alten Knaben auf den Beifahrersitz seines Lada und fuhr los. Zwischen Unter- und Oberberg waren die Grenzzäune abgetragen. Die hässlichen Betonpfeiler und der Stacheldraht waren verschwunden und Joseph fuhr einfach über die Grenze, so als hätte es sie nie gegeben. Wie einfach konnte die Welt sein, dachte er.
Halbstarke Jungs in einem schnittigen BMW überholten ihn grölend, scheinbar amüsierten sie sich über sein für sie ulkiges Fahrzeug.
Ohne Schwierigkeiten fand er das Café, das ihm Marie als Treffpunkt nannte.
Da er etwas zu früh ankam, hob er Lucas aus dem Auto und nahm auf der Terrasse Platz.
Eine junge Bedienung fragte ihn nach seinen Wünschen und als er zögerte sagte sie freundlich: „Keine Sorge, für die von drüben geht alles aufs Haus. Soll ich Ihnen eine Westcola bringen oder ein schönes hessisches Bier? Joseph lehnte dankend ab und bestellte ein Wasser.
Da hielt auch schon ein Audi Kombi vor der Gaststätte. Eine junge Frau stieg aus, gefolgt von einem kleinen Mädchen, das sofort, als sie Lucas auf der Terrasse sah auf ihn zustürzte: Du musst Lucas sein, der Vater unserer Brüder Captain und Condor.
Eine junge Frau folge ihr mit einem Setter an der Leine: Entschuldige Joseph, meine Tochter Corinna ist impulsiv, wenn es um Setter geht.
Sie umarmte Joseph und presste sich fest an ihn: „Das wollte ich schon damals tun, als ich auf deiner Stube an der Grenze war. Das ist Captain, der Grenzgänger. Das hat er wohl von seinem Vater. Er wollte scheinbar schon damals zu dir. Jetzt sollst du ihn haben. Wir haben noch seinen Bruder zu Hause, ein friedlicher Zeitgenosse, das Gegenstück von diesem Rabauken.“
Marie versuchte zu scherzen, was ihr kaum gelang.
Sie nahmen auf der Terrasse Platz. Für Joseph überschlugen sich die Ereignisse, er konnte nicht mehr klar denken, dennoch versuchte er alles zu sortieren: Marie ist Mutter und die kleine Corinna sieht aus wie damals die kleine Marie mit den roten Bäckchen. Er dachte, ich bin zu spät, weil ich damals nachdem wir uns wiedersahen zu feige war, ihr durch die Röhre in den Westen zu folgen oder später den Stacheldraht durchzuschneiden und sie zu suchen.“ Und ihm fiel Gorbatschows lapidarer Satz ein, von dem man gar nicht weiß, ob er ihn wirklich gesagt hat: „Wer zu spät kommt…“
Über Captain freute er sich riesig. Dieser legte, nachdem er seinen Vater abgeschnuppert hatte, seinen Kopf auf Josephs Schoß und sah ihn mit seinen kastanienbraunen Augen an.
„Er wird seinem Vater das Alter leichter und mir das Leben erträglicher machen, so sind wir wenigstens nicht allein“ sagte er zu Marie.
Diese senkte den Blick und strich ihrer Tochter übers Haar.
Joseph stand auf, er verabschiedete sich von der kleinen Corinna und sagte: “Danke, dass du mir den Captain schenkst, ich und Lucas werden gut auf ihn aufpassen.“ Er reichte auch Marie die Hand.
Marie presste ihre kleine Faust in seine Handfläche, so wie sie es als Kind immer tat, wenn sie sich vor etwas fürchtete. So standen sie einen Augenblick.
Dann lösten sich ihre Hände und Joseph ging zu seinem Auto. Captain folgte ihm, so als wäre er in seiner Obhut aufgewachsen.
Er stieg in seinen alten Lada und fuhr wieder zurück. Zurück ins Niemandsland.
Xeno und Kerlchen